
Ohne Kinder in den Kommunismus?
Von Paul
In so gut wie allen gesellschaftlichen Milieus gehören Kinder mit dazu. Nicht nur in der stinknormalen spießigen Kleinfamilie mit zwei Kindern, Hund und Trampolin in Doppelhaushälfte sind Kinder eine Selbstverständlichkeit. Sondern genauso in unterprivilegierten wie sehr wohlhabenden Schichten. Sind Kinder in ärmeren Verhältnissen teilweise derart selbstverständlich, dass Jugendliche und junge Erwachsene hier schon Eltern werden, obwohl sie selber noch bei ihren Eltern wohnen, gelten sie in reichen Kreisen als Statussymbole, die sich, gezielt geplant, mit der Karriere vertragen müssen.
Anders in unseren linken bis linksradikalen Milieus, hier sind Kinder keinesfalls selbstverständlich, denn sie vertragen sich weder mit den linken Karrieren, noch ist es irgendwie cool oder angesagt in unseren Kreisen Kinder zu kriegen. Kinder kommen eher trotz als wegen linken Lifestyles, weshalb sie und ihre Eltern in der linken Szene nur am Rande dazugehören und nicht selten raus gedrängt werden, wenn auch nicht in direkter persönlicher Absicht, so doch strukturell bedingt.
Warum aber sind Kinder und ihre Eltern so marginalisiert in unserem linken Milieu und wie können unsere Zusammenhänge kinder- und elternfreundlich werden, ohne gleichzeitig so angepasst und systembejahend zu werden wie der Rest der Gesellschaft?
Vermutlich ist die Frage schon falsch gestellt, übernimmt sie doch das gängige linke Vorurteil vom Zusammenhang von Kindern und Angepasstheit an die bürgerlichen Verhältnisse.

Dem verständlichen Abgrenzungswillen gegen die Zumutungen und Fremdbestimmungen unsere Gesellschaft und ihrer falschen Freiheit, wie sie in diesem Sticker auf den Punkt gebracht sind, wird die Idee der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung gegenübergestellt, die demnach nicht mit Kindern zusammengedacht werden kann.

Natürlich müssen nicht alle Menschen Kinder bekommen, aber so zu tun, als würden sie nicht dazugehören, oder nur die Anderen betreffen, ist eine zutiefst antigesellschaftliche und damit asoziale Position, die null emanzipatorisches Potential birgt. Denn ohne Kinder kein Fortbestand menschlichen Lebens und damit jeder Form von Gesellschaft. Auch eine nachkapitalistische bessere Gesellschaft wäre ohne Kinder spätestens nach 100 Jahren vorüber.
Klar gibt es radikal feministische Positionen, die sich bewusst gegen Kinder und Mutterschaft, und/oder gegen Männer im Allgemeinen aussprechen. In einer patriarchalen Gesellschaft eine nachvollziehbare Position, doch leider auf Dauer ohne emanzipatorisches Potential, soll mit dem Patriarchat nicht die Menschheit an sich verschwinden. Auch ein Ziel, aber das wäre auf andere Weise schneller und gründlicher zu erreichen. Während die radikal feministische Position kaum noch verbreitet ist, ist die Ausgrenzung von Eltern und Kindern weiterhin gängige Praxis in unserem Milieu. Bei anderen Aufgaben der Reproduktion ist das inzwischen, dank feministischer Kämpfe, bei uns angekommen. Männer die mit Putzen und Kochen nichts zu tun haben wollen, holen sich mindestens einen verbalen Arschtritt ab. Dagegen bilden Menschen, die kein gesteigertes Interesse an Kindern haben den Kern unserer Szene und bringen sich gegenseitig auch viel Verständnis für ihr Desinteresse entgegen, sollte es überhauptmal zur Sprache kommen. Dieses Desinteresse ist übrigens ein zutiefst sexistisches, trifft es doch zum Großteil Frauen, die mit den die Kinder betreffenden Reproduktionstätigkeiten alleingelassen werden. Anstatt sich also diese notwendigen, da Gesellschaft an sich reproduzierenden, Reproduktionstätigkeiten untereinander solidarisch aufzuteilen, wird lieber ganz auf Kinder verzichtet. Weshalb die, die dennoch Kinder haben, mit diesen alleine gelassen werden. Aus weiblicher Perspektive ist es nachvollziehbar, lieber ohne Kinder zu leben, als alleine mit Kindern. Dass die allermeisten Männer, auch die linken, es natürlich finden sich nicht in gleichen Teilen zeitliche wie emotionale um Reproduktionstätigkeiten zu kümmern, egal ob putzen, kochen oder Kinder betreuen, sondern diese Tätigkeiten wie selbstverständlich auf Frauen auslagern, ohne dass es ihnen unangenehm wäre, ist erbärmlich.
Die männliche Selbstherrlichkeit und ihre radikalfeministische Antwort mal ausgeklammert, wie ließe sich ein Zusammenleben mit Kindern in die herrschenden Vorstellungen von Autonomie, verstanden als Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, integrieren? Und woher kommen eigentlich unsere spezifischen Vorstellungen von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung?
Die Jugend als Ausgangspunkt individueller Autonomievorstellungen
Autonomie bezeichnet „den Zustand der Selbstbestimmung, Unabhängigkeit (Souveränität), Selbstverwaltung oder Entscheidungsfreiheit.“ (Wikipedia). Autonomie hat in erster Linie etwas mit politischer Selbstbestimmung zu tun und ist in diesem Sinne ein wichtiger Punkt auf dem Weg in eine nachkapitalistische Gesellschaft. Individuelle Autonomievorstellungen erweitern diesen Begriff auf jegliches Verhältnis zwischen dem Selbst und den Anderen, bei dem mentale Eigenständigkeit und/oder individuelle Ungebundenheit besteht. Diese spezifisch individuellen Autonomievorstellungen bilden sich in Kindheit und Jugend heraus.
Die Kindheit: In vorkapitalistischen Gesellschaften mit überwiegender Subsistenzproduktion, also nur wenig Mehrprodukt, wurden Kinder, sobald sie die notwendigen basalen motorischen und geistigen Fähigkeiten hatten, auf Tätigkeiten der familialen Reproduktion vorbereitet. In Bauern- und Handwerksfamilien halfen sie schon in jungen Jahren auf dem Feld, im Haushalt oder der Produktion, in wohlhabenderen, bürgerlichen Familien wurde sie durch HauslehrerInnen in ihre spätere gesellschaftliche Position hinein diszipliniert und gebildet. Durch die Herausbildung kapitalistischer Verhältnisse wurden viele Familien ihrer Subsistenz beraubt und die Kinder proletarisierter Familien wurden nicht nur teilweise in den Fabriken geboren, sondern auch sobald sie dazu fähig waren dort als Arbeitskräfte ‚beschäftigt‘. Zu Beginn des 19.Jh war ein Drittel der FabrikarbeiterInnen in den USA zwischen 7 und 12 Jahren alt, erst seit 1973 ist Kinderarbeit durch ein ILO Richtlinie international geächtet. Das kindliche Spiel ging somit, außer in den herrschenden Schichten, direkt in die Arbeit über, ein Übergangszeitraum, auch Jugend genannt, war nicht vorgesehen.
Die Jugend: Erst im späten 19. Jahrhundert begann sich das Phänomen der Jugend zunächst in bürgerlichen Kreisen herauszubilden. Einer der Auslöser war die Verwissenschaftlichung der Produktion, also der Bedarf an immer umfassender und spezialisierter ausgebildeten Arbeitskräften. Dieser Bedarf steigt immer weiter, sodass inzwischen in den hoch industrialisierten Gesellschaften alle Kinder von ihrem 6ten bis mindestens zu ihrem 16ten Lebensjahr Schulbildung erhalten und über 50 Prozent eines Jahrgangs in der BRD nach dem Abitur mit etwa 18 Jahren noch ein langjähriges Studium dranhängt. Gerade aus letzterem Teil der Jugendlichen aus Akademiker-Haushalten speist sich ja auch die linke Szene. Folglich bleibt über der Hälfte der Jugendlichen, Tendenz steigend, vom Beginn ihrer Jugend mit 13 Jahren bis zum Eintritt in das Berufsleben ein Zeitraum von mindesten 10, wenn nicht gar über 15 Jahren, in dem neben der Ausbildung, oft noch einiges an Zeit für allerlei anderes, vor allem Selbstbezogenheit bleibt.
In dieser Lebensphase in der sich die allermeisten Jugendlichen mehr oder weniger aus der Kontrolle und den Erwartungen ihrer Eltern emanzipieren, entsteht mit wachsender Selbstständigkeit das Gefühl von Unabhängigkeit: Du bist immer öfter ohne Eltern unterwegs, ab und zu kochst du dir mal selber was, du erlebst häufiger Streits mit anderen ohne elterliche Schlichtung und du kannst vermehrt eigene Entscheidungen treffen, immer öfter auch gegen den Willen oder ohne die Zustimmung, oder das Wissen deiner Eltern. Was allgemein bei soviel neu gewonnen Freiheiten, Entscheidungskompetenzen und mentaler Eigenständigkeit vergessen wird, ist die fortbestehende logistische und ökonomische Abhängigkeit von den Eltern, denn auch wenn du mit deinem Taschengeld machen kannst was du willst, kommt es dennoch von deinen Eltern und dann wären da ja noch die Wohnung, das Fahrrad, das Auto, die Kleidung, das Essen, Handy, Laptop und Fernseher etc.. Und auch bei vielen anderen Sachen wärst du ohne deine Eltern ziemlich aufgeschmissen gewesen, sei es die Begleitung aufs Revier, als du das erste Mal beim Klauen erwischt wurdest, oder die Hilfe bei den Hausaufgaben und der Besuch des Elternsprechtags, damit deine Versetzung in die nächste Klasse doch noch klappt, oder der Anruf beim Arzt, um einen Termin auszumachen, weil der Intimbereich juckt.

 Mag die freie Verfügung über das zugeteilte Taschengeld noch Unabhängigkeit vorgaukeln, sticht bei genauerer Betrachtung die vollkommene ökonomische und logistische Abhängigkeit von den Eltern schmerzhaft ins Auge. Die bei den meisten auch noch während des Studiums besteht und erst mit dem Beginn der Lohnarbeit, also Ende 20, Anfang 30, überwunden wird. Mal ganz abgesehen von der mentalen Abhängigkeit, selbst mit Ende 20, wenn du mal wieder zu Besuch bist: „Ja Mama, ja ich kümmer mich drum … ; Achso und könntest du mir noch …, Danke!“.
Mag die freie Verfügung über das zugeteilte Taschengeld noch Unabhängigkeit vorgaukeln, sticht bei genauerer Betrachtung die vollkommene ökonomische und logistische Abhängigkeit von den Eltern schmerzhaft ins Auge. Die bei den meisten auch noch während des Studiums besteht und erst mit dem Beginn der Lohnarbeit, also Ende 20, Anfang 30, überwunden wird. Mal ganz abgesehen von der mentalen Abhängigkeit, selbst mit Ende 20, wenn du mal wieder zu Besuch bist: „Ja Mama, ja ich kümmer mich drum … ; Achso und könntest du mir noch …, Danke!“.
Jetzt wo sich das damalige Gefühl von individueller jugendlicher Unabhängigkeit und Selbstständigkeit überwiegend als Schein entpuppt hat, lohnt sich ein Blick auf die gefühlte Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bei Erwachsenen.

Das ist zwar durchaus zutreffend, allerdings nur auf Basis eines gesellschaftlichen Ganzen. Zwar gibt es auch Versuche nicht nur mental, sondern auch im Hinblick auf die notwendigen Lebensmittel möglichst unabhängig und selbstbestimmt zu leben, aber selbst die Bewohner*innen des autonomen Wagenplatzes mit Kompostklo und Frischwasserbrunnen müssen essen und sind auf Werkzeug und Medizin angewiesen. Auch wenn alles geklaut wird, muss es von irgendwem hergestellt worden sein und werden sie erwischt, dann kommt die Polizei.
Persönliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, in mentaler, ökonomischer und politischer Hinsicht sind also niemals total, sondern immer an den gesellschaftlichen und familiären Kontext gebunden, dementsprechend können sie mal kleiner mal größer sein.
Die Abhängigkeit und Unselbstständigkeit der Kindheit geht einher mit Verantwortungslosigkeit gegenüber sich selbst und anderen. Während sich in der Jugend nach und nach Selbstständigkeit entwickelt und damit Unabhängigkeit gengenüber den Eltern und dadurch auch immer mehr Verantwortung für sich selbst und die eigenen Entscheidungen übernommen werden muss, bleibt die Verantwortungsübernahme für andere merkwürdig unterentwickelt. Auch wenn beide Eltern arbeiten, sind die jüngeren Geschwister betreut von Kindergarten oder Schule und da die eigenen Eltern noch nicht pflegebedürftig sind und noch keine eigenen Kinder existieren, muss wenn es hoch kommt gerade mal für den Wellensittich oder das Meerschweinchen Verantwortung übernommen werden.
In der Jugend paart sich das Gefühl von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit mit einer häufig ausgeprägten realen Verantwortungslosigkeit (mag sie sich auch manchmal als ihr Gegenteil anfühlen: immer muss ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen damit meine Eltern mal ausgehen können) gegenüber den engsten Mitmenschen, oft genug auch noch gegenüber sich selbst, der Umwelt und allem anderen. Umgekehrt wird die Übernahme von Verantwortung in Zusammenhang mit den Institutionen und Situationen der Fremdbestimmung und Abhängigkeit erfahren. Sobald in der Schule, Uni oder Ausbildung vermehrt Verantwortung übernommen werden muss, soll wenigstens die Freizeit frei davon sein und bleiben.
Diese zwei Dreiklänge aus Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Verantwortungslosigkeit auf der einen Seite und Fremdbestimmung, Abhängigkeit und Verantwortung auf der anderen Seite sind der Ausgangspunkt fast aller jungen Menschen, wenn sie in die ernste Welt des Erwachsenseins starten, also auch derjenigen die ins linke Milieu finden. Hier wird der erste Dreiklang unkritisch übernommen und es gilt den zweiten Dreiklang zu bekämpfen um sich von den Zwängen der Ausbildung, des Jobs und des kapitalistischen Systems als Ganzem zu befreien. Bis das geschafft ist, wird versucht schon möglichst autonom zu leben und da ist jede Verantwortungsübernahme eine Belastung, die nicht auf den ersten Blick mit dem Ziel der Emanzipation in Verbindung gebracht werden kann.
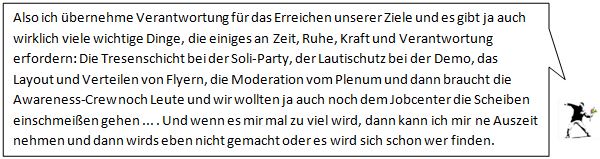
Und plötzlich kriegt eine Genossin ein Kind. Worauf sie in der darauf folgenden Zeit nach und nach etwa folgendes zu hören kriegt:

Verantwortung für andere zu übernehmen, gerade für Kinder, ist eben etwas qualitativ anderes, als eine Tresenschicht oder Plenumsmoderation zu übernehmen. Die Verantwortung für ein Kind wirst du nicht mehr los und sie wird dir auch nicht abgenommen, es sei denn du machst dich aus dem Staub. Denn Verantwortung für Kinder ist verbindlich und langwierig und es erschließt sich scheinbar für viele nicht, wie diese Verantwortungsübernahme uns unseren Zielen einer besseren Gesellschaft näher bringt, denn sie lässt sich weder mit der herrschenden linken Praxis verbinden noch mit dem vorherrschenden linken Verständnis von Autonomie zusammendenken.
Auch die zweite Frage war somit falsch gestellt, denn das Problem ist nicht, wie sich Kinder in die herrschenden Vorstellungen von Autonomie im linken Milieu integrieren lassen, sondern wie diese Vorstellungen selbst, da sie Kindern und Eltern nicht gerecht werden können, zu verändern sind. Es gilt also die individuellen Autonomievorstellungen kritisch zu hinterfragen und zu verändern.
Aber in welche Richtung muss sich unser Verständnis von Autonomie verändern damit es dem Ziel einer besseren Gesellschaft gerecht wird?
Der Weg der Emanzipation
Ziel unserer Emanzipation ist die umfassende Veränderung der gegenwärtigen Gesellschaft, damit die Aufhebung jeglicher Herrschaftsstrukturen, der Konkurrenz um Macht, Geld, Zeit und Ressourcen, der Vereinzelung, sowie der Entfremdung von unseren Tätigkeiten, deren Produkten, uns selbst und damit auch den anderen Menschen und der Natur. Den herrschenden Zustand, in welchem wir unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse verstümmeln und diese über Geld miteinander vermitteln, wir uns somit gegeneinander und abstrakt hinter unseren Rücken vergesellschaften, wollen wir in eine bewusste konkret Vergesellschaftung überführen, in der wir unsere Fähigkeiten und Bedürfnissen miteinander frei entfalten können und wir uns dadurch als Teil eines gesellschaftlichen Ganzen begreifen, in welchem wir uns in unseren individuellen und gleichzeitig gesellschaftlichen Tätigkeiten selbst und damit das Ganze verwirklichen (Keiner hat das schon so früh und prägnant auf den Punkt gebracht wie Marx in den Pariser Manuskripten von 1844).
Damit wir diese Ziele verwirklichen können, müssen diese schon in unserem Verhalten erkennbar sein, die Mittel auf unserem Weg der Emanzipation müssen ihrem Zweck entsprechen. Diese Erfahrung bleibt zurück aus allen bisherigen großen Emanzipationskämpfen, ob Russland 1917, Spanien 1936, oder 1968. Die Revolutionen und Revolten sind im Großen in den herrschenden Verkehrsformen hängen geblieben, auch wenn es starke Momente der Revolutionierung dieser Verkehrsformen gab, konnten diese nie in der Masse umgesetzt und dann auch durchgehalten werden, dies ist aber zentral, soll die Veränderung tatsächlich grundlegend und allumfassend sein. Die Veränderung muss das gesellschaftliche Ganze betreffen und nicht nur einige Teilbereiche, es reicht nicht die Produktion umzugestalten, gleichzeitig muss sich auch der Reproduktionsbereich verändern.
Und während nur die wenigsten in der linken Szene im Produktionsbereich unterwegs sind, betrifft der Reproduktionsbereich uns alle. Hier gibt es auch keine Ausreden mehr das eigenen Verhalten nicht zu verändern, denn es gibt keine Chefs, keine Gewerkschaftsführung und keine politisch-taktischen Kompromisse und erst recht keine ’notwendige‘ strategische Zurückhaltung, um das Agitationsobjekt da abzuholen wo es vermeintlich steht, ohnehin eine sehr fragwürdige, bevormundende und arrogante Herangehensweise. Die Losung das ‚Private ist Politisch‘ war nicht als Lippenbekenntnis gedacht, sondern ernst gemeint. Es wäre viel gewonnen würden wir es schaffen unsere eigenen Verhaltensweisen im Reproduktionsbereich zu revolutionieren, gerade auch was das Zusammenleben mit Kindern angeht.
Aber hierfür müssten wir unsere Vorstellungen von Autonomie überdenken und verändern und das scheint gar nicht so leicht. Wie gezeigt, hat sich unsere Vorstellung von Autonomie eng mit dem Zustand der Verantwortungslosigkeit gegenüber anderen verknüpft, langfristige verbindliche Verantwortung für andere zu übernehmen scheint daher keine Option. Aber genau diese langfristige Verbindlichkeit ist nötig um sich auf Kinder einzulassen. Denn die wirst du in der Regel nicht mehr los und bis die ausziehen und ein eigenständiges Leben führen, vergehen 15 bis 25 Jahre, wie du an dir selber nachvollziehen kannst. Da Kinder nun mal trotzdem zu jeglicher Form von Gesellschaftlichkeit dazugehören, sollten wir uns lieber überlegen, wie wir sie in unser Leben integriert kriegen ohne dabei unsere Unabhängigkeit und Selbstbestimmung aufgeben zu müssen. Denn bedeuten Kinder für ihre engsten Bezugspersonen, in aller Regel ausschließlich ihre Eltern, oft auch nur ihre Mutter, einen tatsächlichen Verlust von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Als erstes ist es dafür hilfreich Autonomie nicht weiter als Ungebundenheit und diese dann als Voraussetzung für Selbstbestimmung zu verklären. Vielmehr sollte individuelle Autonomie in kollektive Autonomie aufgelöst werden. Denn wie das individuelle Leben nur in Abhängigkeit zu anderem Leben existieren kann, ist auch jede Form von Selbstbestimmung an ihren Kontext gebunden und der ist nie frei von anderen Menschen. Autonomie müsste demnach als selbstbestimmte Abhängigkeit, also kollektiv gedacht werden, wie es auch schon mal in den späten 80ern auf einem Transparent bei einem Kongress der linken Szene zu lesen war: „Autonomie heißt selbstbestimmt Abhängigkeit!“
Gestartet bei der Suche nach den Ursprüngen individueller Autonomievorstellungen und angelangt bei der Erkenntnis ihrer realen Unmöglichkeit, macht es jetzt Sinn die Möglichkeiten kollektiver Autonomie auszuloten und zu überprüfen, inwiefern sie den Zielen unserer Emanzipation gerecht werden.
Autonomie als selbstbestimmte Abhängigkeit
Die als individuelle falsch verstandene Autonomie ist also immer nur eine mehr oder weniger an Abhängigkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung. Die Lebensphase in der die Autonomie am größten scheint, beschränkt sich ja nur auf die wenigen Jahre der Jugend und des jungen Erwachsenseins und endet oft jäh mit dem Eintritt in den Berufsalltag oder der Geburt des ersten eigenen Kindes. Diese vermeintliche individuelle Autonomie müsste eigentlich ehrlicher Weise als unabgesprochenes Ausleben individualisierter Vorstellungen auf den Schultern anderer bezeichnet werden. Eine Lebensweise die sich überhaupt nicht mit unseren emanzipatorischen Zielen und Idealen vereinbaren lässt. Doch gerade in der linken Szene lässt sich dies Phase oft noch ausdehnen, denn erstens wird ein Einstieg in einen normalen Berufsalltag und zweitens die Geburt eines Kindes möglichst vermieden.
Da es ja aber nicht darum gehen kann normale Lohnarbeitsverhältnisse und Kleinfamilienstrukturen, die für sich genommen erst einmal alles andere als emanzipatorisch sind, irgendwie in die linke Szene zu integrieren, müssen wir Alternativen formulieren und auch zu leben beginnen. Vor allem auch dann, wenn wir von einer Szene zu einer gesellschaftsverändernden Bewegung werden wollen.

Natürlich gibt es auch schon ein paar gelebte Alternativen, gerade auch was das kollektive Zusammenleben mit Kinder angeht, doch zeigt die Erfahrung, auch meine eigene, dass diese Alternativen oft mehr Schein als Sein sind, insbesondere was die kollektive Bezugnahme auf Kinder angeht und deshalb leider häufig scheitern. Woran es leider auch allen Zusammenlebensformen mit Kindern mangelt, die ich kenne, – du kennst Gegenbeispiele? Nur her damit! – ist eine kollektive, verbindliche und langfristige Verantwortungsübernahme von Erwachsenen gegenüber Kindern die im biologischen Sinne nicht die eignen sind.
Diese kollektive, verbindliche und langfristige Verantwortungsübernahme für andere muss der emanzipatorische Kern einer Autonomie sein, die sich als selbstbestimmte Abhängigkeit versteht.
Wie könnte die kollektive, verbindliche und langfristige Verantwortungsübernahme gegenüber anderen, insbesondere Kindern konkret aussehen?
Ich denke dabei an Formen des Zusammenlebens, in denen sich mehrere Menschen unterschiedlichen Alters zusammenfinden und miteinander ihr Leben verbringen. Nicht als Zwangsgemeinschaft oder Sekte, sondern in Freiwilligkeit. Wenn es nicht mehr passt, findet sich eine andere Gemeinschaft in der es schön ist. In diesen Gemeinschaften, nennen wir sie Kommunen, leben also Kinder, Jugendliche, junge und alte Erwachsene gemeinsam. Sie übernehmen dabei kollektiv Verantwortung füreinander. Damit würde es keine Phase der Jugendlichkeit im Sinne einer vermeintlichen Unabhängigkeit und realen Verantwortungslosigkeit mehr, aber eben auch keine Phase der unfreiwilligen alleinigen Verantwortungsübernahme für andere, insbesondere das klassische Eltern-(bzw. Mutter-)Kind-Verhältnis, mehr geben. Bei kollektiver Verantwortung füreinander, können sich dann einzelne viel besser auch mal über einen gewissen Zeitraum aus der Verantwortung zurückziehen, weil das vom Kollektiv aufgefangen werden kann, oder sogar kaum ins Gewicht fällt. Es entstehen somit, für alle gleichberechtigt, individuelle Freiräume von kollektiver Verantwortung, ohne dass dies zu Lasten anderer geschieht. Die Verantwortungsverteilung wird dabei selbstverständlich konsensual und kollektiv, das heißt mit allen beteiligten abgesprochen.
Um das verwirklichen zu können, brauchen die Kommunen eine gewisse Mindestanzahl und Quote an Jugendlichen und Erwachsenen die Verantwortung für pflegebedürftige Kinder und alte Menschen übernehmen können, ohne dass es zu Überforderungen kommt und darüberhinaus auch immer wieder einzelne von dieser Verantwortung für einen gewissen Zeitraum entbunden werden können. Diese Kommunen müssen dafür nicht Zusammenhänge von mehreren Dutzend Menschen sein, die bis ins Intimste miteinander vertraut sind, sondern sollten ohne Probleme auch aus mehreren engeren Bezugsgruppen zusammengesetzt sein können, die sich innerhalb der Kommune aufeinander beziehen. Unabdingbar für das Gelingen dieser Form von Kollektivität ist allerdings, dass vor allem die Kinder mehrere enge Bezugspersonen haben, mit denen sie auch mal für ‚längere‘ Zeit, ohne die jeweils anderen Bezugspersonen, auskommen könnten. Diese geteilte Verantwortungsübernahme gegenüber Kindern und den pflegebedürftigen Alten kann natürlich auf verschiedene Weise organisiert sein. Wichtig ist es, dass vor allem die Kinder ein Vertrauensverhältnis zu ihren Bezugspersonen haben und von diesen im Ganzen ausreichend Liebe und Zuwendung erfahren.
Dabei kann es ganz verschiedene Möglichkeiten des Bezugnehmens geben, die zwischen sehr enger dauerhafter Bezugnahme (vergleichbar der üblichen Elternschaft) bis zu loser aber regelmäßiger Bezugnahme (vergleichbar der üblichen Großelternschaft) gehen. Wichtig ist dabei, dass für das Kind gerade in den ersten 10 Jahren ein verbindliches Vertrauensverhältnis besteht, dass die Bezugspersonen in der entsprechenden Regelmäßigkeit für das Kind da sind und es in seiner Entwicklung begleiten und nicht immer mal wieder wegbrechen und durch andere ersetzt werden. Deshalb muss sich im Vorhinein überlegt werden, in welchem Maße und in welcher Zeitspanne sich von den einzelnen Bezugspersonen auf das Kind eingelassen werden kann.
Diese Kommunen können dann einen Ausgangspunkt bilden, von dem aus der Kampf ums Ganze über die Kommunen hinaus aufgenommen werden kann. Die kollektive Elternschaft als neue Form der Familie bildet dabei die Keimform für die neuen emanzipatorischen Verkehrsformen, die es dann zu verallgemeinern gilt.
Eine kurze Gebrauchsanweisung wie alles besser wird:
Um kollektive Elternschaft ermöglichen zu können braucht es:
- Ein radikales Umdenken in der linken Szene bezüglich des Zusammenlebens mit Kindern: Kinder gehören dazu, bezieht euch auf sie!
- Erwachsene, die sich verbindlich auf Kinder einlassen, auch wenn es nicht ihre biologisch eigenen sind: Schon mal über Co-Elternschaft nachgedacht?
- Wohnraum, in dem Erwachsene in kollektiver Elternschaft mit Kindern zusammenleben können: Single Hausprojekte für Kommunen räumen. Deinen individualisierten linken Szene-Lifestyle kannst du auch in einer WG ausleben, dafür musst du nicht den ohnehin knappen Wohnraum in Hausprojekten besetzen, den Care Communitys wegen ihrer Größe so dringend brauchen.
Du hast kein eigenes Kind, willst Eltern und Kinder aber darin unterstützen weiterhin Teil der linken Szene bleiben zu können? Folgendes kannst du tun:
- Frag sie was sie brauchen und biete Eltern und Kindern deine Hilfe an. Eventuell könntest du dann mal Babysitten oder Einkaufen gehen, oder was kochen. Sobald du dem Kind vertraut bist kannst du dann sogar mal was mit dem Kind unternehmen.
- Überlege wie du die Veranstaltung oder deine Gruppenpraxis so organisierst, dass auch Eltern teilnehmen können.
- Versuch in deiner WG oder deinem Hausprojekt Raum für Eltern und Kinder zu schaffen.
- Verdräng Kinder und Eltern nicht aus bestehenden WGs oder Hausprojekten. Zieh bei Konflikten lieber selber aus, bevor es Eltern und Kinder machen müssen.
Es hängt somit in erster Linie an den bisher kinderlosen Erwachsenen, ob sich grundlegend was ändert oder nicht. Für die Selbstkritik linker Eltern bleibt dann immer noch genügend Zeit, wenn es so weit ist. In diesem Sinne:

Autor:
Paul will alles und zwar sofort. Ansonsten lebt er mit zwei Kindern und Freundin zusammen auf der Suche nach neuen Gefährt*innen, nachdem sich die Wege der ersten Wohngemeinschaft mit Kindern getrennt haben.

